
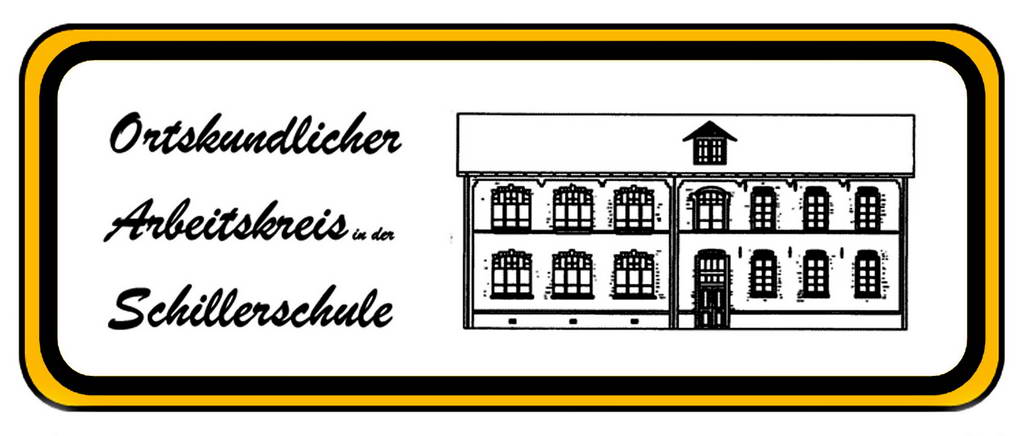


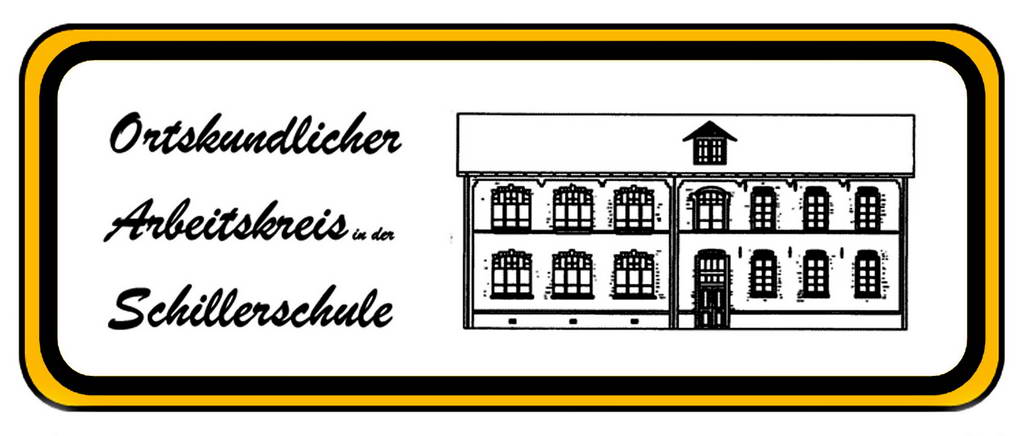 
|
Ortskundlicher
Arbeitskreis
Erinnerung an das Kriegsende
Donnerstag 8. Mai 2025 ab 18:30 Uhr
| „Tag der Befreiung“, „Tag der bedingungslosen Kapitulation“ oder auch „Tag des Sieges“: Heute vor 80 Jahren wurde mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg beendet. Zur Erinnerung an diesen Tag hat Hans Schmidt vom Ortskundlichen Arbeitskreis eine Gedenkveranstaltung ins Leben gerufen. In diesem Jahr trafen sich Erzhäuser Bürger auf dem Friedensplatz. |
| Artikel im Erzhäuser Anzeiger vom 15. Mai 2025: |
|
Gedenken an den 8. Mai 1945 |
|
(gw) Am Abend des 8. Mai 2025 trafen sich viele Erzhäuser Bürger am Friedensplatz gegenüber dem Seniorenheim, um gemeinsam an das Kriegsende vor 80 Jahren zu erinnern. Das Geläut der Evangelischen Kirche begrüßte die Gäste. Um 18:30 Uhr begrüßte unsere Bürgermeisterin Claudia Lange die Gäste und gab eine kurze Einleitung zu dem Gedenktag. Sie erinnerte daran, dass es ohne die Initiative von Hans Schmidt diesen Platz nicht geben würde, und sie erinnerte auch daran, dass bereits vor 5 Jahren eine solche Feier am Friedensplatz stattfinden sollte, diese aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Wolfgang Demmel umrahmte diese Feier musikalisch und eröffnete die Veranstaltung mit einem stimmungsvollen Adagio. Danach hielt Claudia Lange einen Vortrag, in dem sie auch an die vielen Toten im Zweiten Weltkrieg erinnerte. Der 8. Mai 1945 war deshalb ein Tag der Befreiung – so wie es Richard von Weizsäcker in seiner Rede vor 40 Jahren zum Ausdruck brachte. Claudia Lange sagte „Nun |
sind 80 Jahre vergangen, und wieder sehen wir Krieg in Europa. Deshalb ist Erinnerung eine Verpflichtung zur Wachsamkeit und eine Kraftquelle für unsere Zukunft“. Danach hielt Klaus Becker vom Ortskundlichen Arbeitskreis einen außerordentlich interessanten Vortrag. Er sagte: „In einer solchen Rede Geschehnissen auf regionaler, ja lokaler Ebene, einen Platz einzuräumen, ist aus meiner Sicht eine kluge Idee.“ So berichtete er über die Ereignisse in Erzhausen in der Zeit von 1933 bis 1945, in dem er zeigte, dass auch in Erzhausen viele Gräuel von den Nationalsozialisten an den Einwohnern begangen wurden. Für seinen Vortrag erhielt Klaus Becker langanhaltenden Beifall, einige der Zuhörer sprachen anschließend noch lange mit Klaus Becker über seinen Vortrag. Den Abschluss der Veranstaltung bildete das Lied „What a wonderfull world“, gespielt und gesungen von Wolfgang Demmel, mit dem er auch daran erinnerte, wie gut es unserer Gesellschaft heute geht. Danach gingen die Gäste ruhig und sehr nachdenklich nach Hause. |
|
Am Abend des 8. Mai 2025
trafen sich viele Erzhäuser Bürger am Friedensplatz, um gemeinsam an das Kriegsende vor 80 Jahren zu erinnern:
Um
18:30 Uhr begrüßte Bürgermeisterin Claudia Lange die Gäste. In ihrer
Eröffnungsansprache
Musikalisch wurde die
Feier von Wolfgang Demmel begleitet,
Anschließend hielt Claudia Lange einen bewegenden Vortrag. Sie erinnerte an
die zahllosen
Ein
weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war der Vortrag von Klaus Becker vom
Für seinen Beitrag
erhielt er langanhaltenden Applaus, und
|
|
Den musikalischen Schlusspunkt setzte erneut Wolfgang Demmel mit dem Lied „What a Wonderful World“, das er gefühlvoll spielte und sang. Damit erinnerte er nicht nur an das Gute in der Welt, sondern auch an die Verantwortung, dieses Gute zu bewahren. Nachdenklich und still verließen die Gäste im Anschluss den Friedensplatz – getragen von der Erinnerung, der Mahnung und der Hoffnung auf eine friedliche Zukunft. |
|
Für Interessierte hier die beiden Vorträge im
vollständigen Wortlaut: Zunächst der Vortrag von Claudia Lange:
|
|
Ansprache zum 80. Jahrestag des Endes des
Zweiten Weltkriegs
Herzlich Willkommen Wir versammeln uns heute hier, um innezuhalten – 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Klaus Becker, Autor und aktiv im Ortskundlichen Arbeitskreis, und ich haben heute Abend ganz gezielt einen kleinen Kreis derer eingeladen, die in besonderer Weise Verantwortung übernehmen, hier, auf lokaler Ebene in unserem Erzhausen. Ich freue mich darum sehr über die große Resonanz. Besonders begrüße ich den Ehrenvorsitzenden der Gemeindevertretung Heinz Weber und die Vorsitzende der Gemeindevertretung Tanja Launer. Und wir danken herzlich dem Ehrengemeindevertreter Wolfgang Demmel, der diese Gedenkstunde musikalisch umrahmt. Als Ort für diese Versammlung haben wir den Friedensplatz gewählt. Entstanden ist dieser Platz mit seinem Denkmal auf Initiative des Erzhäusers Hans Schmidt, der heute auch hier unter uns erwartet wird. Dieser Platz sollte zum 75. Jahrestag des Kriegsendes eingeweiht werden. Zu dieser Zeit konnte eine solche Veranstaltung aber wegen der kurz zuvor nach Deutschland eingeschleppten Corona Pandemie nicht stattfinden. Darum wurde der Friedensplatz vor drei Jahren mit einer feierlichen, großen Veranstaltung eröffnet. Während wir uns Anfang des Jahres 2020 in Deutschland und in Europa in einer Zeit des Friedens wähnten, war dies bereits zur Einweihung der Friedensanlage am 8. Mai 2022 anders. Denn am 24. Februar 2022 hatte Rußland die Ukraine überfallen. Und unsere Freunde aus unserer Partnerstadt Ivanychi, Arbeitskollegen in ukrainischen Filialen und Tochtergesellschaften, Verwandte und Freunde von Erzhäuser Bürgern waren plötzlich im Krieg. Alle Wünsche und Hoffnungen, dass dieser Krieg schnell zu Ende gegen würde, haben sich nicht erfüllt. Stattdessen verfolgen wir seit mehr als drei Jahren Nachrichten über Tod und Zerstörung. Aber nicht nur dort, besonders in Israel und im Gaza-Streifen leidet die Zivilbevölkerung in unerträglicher Weise. Und seit gestern flammt der Konflikt zwischen Indien und Pakistan wieder auf, und die Beteiligten sprechen von möglichen Einsätzen von Atomwaffen. Wenn wir heute, unter dem Eindruck der aktuellen Entwicklungen in der Welt, über 80 Jahre Frieden in Deutschland und Europa sprechen, wird uns bewusst, wie kostbar diese Zeit war und ist, und dass eine solch lange Friedensperiode nicht selbstverständlich ist. Der 8. Mai 1945 markierte das Ende eines verheerenden Krieges und das Ende des Nationalsozialismus. Es kam die Kapitulation, aber gleichzeitig der Beginn einer neuen Ära des Friedens und der Tag der Befreiung – so hat es Richard von Weizsäcker vor 40 Jahren in seiner großen Rede zum Ausdruck gebracht. Eine Rede, die auch mich persönlich tief beeindruckt hat. Er sprach davon, dass der 8. Mai nicht der Tag der Niederlage sein dürfe, sondern der Tag der Befreiung von einem menschenverachtenden System. Und er sagte: „Der 8. Mai war ein Tag der Hoffnung.“ Die Tage rund um den 8. Mai 1945 waren auch für die Erzhäuser Tage der Unsicherheit – aber auch des Überlebens. Häuser standen, Felder waren bestellt, Familien hatten sich verloren und wiedergefunden. In Erzhausen waren seit dem 25. März 1945 die amerikanischen Truppen. Dies bedeutete einerseits Befreiung, andererseits wurden viele Häuser von den Amerikanern besetzt. Es gab Erleichterung über das Kriegsende und gleichzeitig Angst und Ungewissheit, Trauer um Gefallene, Vermisste, Vertriebene – und viele offene Wunden. Nun sind 80 Jahre vergangen. Die Kinder von damals sind alt geworden. Manche von ihnen haben uns ihre Geschichten erzählt – in den Familien, in der Schule, in der Gemeindechronik. Hans Schmidt hat kürzlich in einer Veranstaltung in der Hessenwaldschule zum Gedenken an den 25.3.1945 berichtet. Er beschrieb, wie schwer es nach dem Kriegsende fiel, über die Geschehnisse zu sprechen. Dass vielfach in den Familien Sprachlosigkeit herrschte. Diejenigen, die jetzt noch darüber aus eigener Erfahrung sprechen können, werden weniger. Es ist an uns, den Jüngeren, zu bewahren, was sie uns mitgegeben haben: Erinnerung, Verantwortung, Mahnung. Darüber wird Klaus Becker gleich zu uns sprechen. Wir leben heute in einer Zeit des Friedens – aber nicht in einer friedlichen Welt. Wir sehen wieder Krieg in Europa. Wir erleben, wie Sprache verroht, wie Hass wächst, wie demokratische Werte in Frage gestellt werden – auch bei uns. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Generationen zusammenstehen. „Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet wird, ist eine Gegenwart, die uns blind macht.“ Deshalb ist Erinnerung keine Last, sondern eine Haltung. Eine Verpflichtung zur Wachsamkeit. Und eine Kraftquelle für unsere Zukunft. Erzhausen steht heute für eine engagierte, offene Gemeinschaft, für Vielfalt und für ein demokratisches Miteinander. Auch Erzhausen ist nicht perfekt – aber wir wissen, wo wir herkommen, wir bewahren unsere Geschichte. Und wir wissen, was wir verteidigen wollen: Menschlichkeit. Zusammenhalt. Frieden.
Ich danke Ihnen, dass Sie heute
hier sind. Vielen Dank. |
| Und hier nun der Vortrag von Klaus Becker: |
|
Sehr geehrte Anwesende: „Der 8. Mai 1945 war das Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, das Ende von Bombennächten und Todesmärschen, das Ende beispielloser deutscher Verbrechen und des Zivilisationsbruches der Shoah.“ So begann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ansprache zum 8. Mai 1945 – am 8. Mai 2020, vor fünf Jahren. Auch in diesem Jahr wird Bundespräsident Steinmeier eine Rede zum 8. Mai 1945 halten, die die großen Linien der europäischen Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachzeichnet. Ein Kennzeichen seiner Reden zu diesem Thema, ich habe mir einige seiner Reden aus den letzten Jahren angeschaut, ist jedoch auch, dass er oft von Ereignissen im Kleinen, von Vorgängen an Ort und Stelle erzählt. In einer solchen Rede Geschehnissen auf regionaler, ja lokaler Ebene, einen Platz einzuräumen, ist aus meiner Sicht eine sehr kluge Idee. Es ist doch wichtig, die lokalen Ereignisse in den Zusammenhang der großen Linien einzubetten und umgekehrt zu berichten, was die große Politik auf lokaler Ebene bewirkte. Heute werden nicht nur in Deutschland, sondern wohl in allen Teilen der Welt weitere Reden zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 gehalten. Wir werden einige davon mit Interesse und Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen und uns auf diese Weise mit der Katastrophe dieses Krieges befassen - und mit der Herrschaft der Nationalsozialisten, die diesen Krieg erzeugte – im europäischen Kontext. Damit habe ich zwei Gründe, mich in meiner Rede hier, in Erzhausen, mit lokalen Verhältnissen, mit Ereignissen, die hier im Zusammenhang mit dem 8. Mai 1945 stattfanden, zu beschäftigen. Ein Anstoß für meine Arbeit an dem Buch „Orte des Gedenkens - drei Denkmale und ein Gräberfeld“, das wir vom Ortskundlichen Arbeitskreis vor zwei Jahren herausbrachten, waren die Bronzetafeln an dem Gedenkstein mit der Dornenkrone, den ich bis dahin als nackten Würfel im Gedächtnis hatte. Aufgewühlt, ja aufgeregt hatten mich die Tafeln mit den Namen der im Zweiten Weltkrieg Gefallenen und Vermissten. Schon die schiere Zahl der Namen, insgesamt sind es 170, nahm mir den Atem, so dass ich beschloss, dem Schicksal dieser Männer nachzugehen. Tatsächlich war es mir dann möglich, mit Hilfe der lebenden Angehörigen etliche Lebenswege nachzuzeichnen und daraus „Biographische Skizzen“ mancher Männer, deren Namen dort zu lesen sind, zu entwerfen. Doch daraus entstand ein schwieriges Dilemma: Diese jungen Männer, Väter, Brüder wurden durch den Krieg aus ihren Familien, aus ihrem Berufsleben aus ihrer Aussicht auf ein glückliches Leben herausgerissen. Aus Familien aus unserer Mitte, mit denen wir heute noch Umgang pflegen können. Sie sind uns nah. Also nehmen wir Anteil an ihrem Leid, am Leid ihrer Familien. Aber sie waren keine Freiheitskämpfer, sie haben nicht für die Freiheit ihres Landes, unseres Landes, gekämpft. Sie waren vielmehr Teil der Streitmacht einer Diktatur, die diesen Krieg in unsere Nachbarländer gebracht hat. Hegemonie über die Menschen in unseren westlichen Nachbarländern, Versklavung der Völker im Osten, Vernichtung der Juden – das waren die Kriegsziele der obersten Anführer dieser Diktatur. Auf deren Befehl hin zogen Millionen deutscher Soldaten in diesen Krieg, desinformiert, verblendet, vielfach aber auch fanatisch für die Ziele ihrer Kommandeure kämpfend. Sie haben unendliches Leid über die Menschen in diesen Ländern und auch über uns Deutsche gebracht. Darunter waren auch die, deren Namen wir heute auf den Bronzetafeln lesen. Die anderen deutschen Soldaten, die das Glück hatten, das eigene Leben retten zu können, „mussten erkennen, dass ihr eigenes Leid und das ihrer Familie zu Hause nicht nur vergeblich, sondern auch sinnlos war – und im Einsatz für ein gigantisches Verbrechen geschah.“ So hat es vor nunmehr vierzig Jahren ein anderer Bundespräsident, Richard von Weizsäcker, ausgedrückt. Wie also sollen wir der deutschen Soldaten, der Erzhäuser Soldaten, gedenken? Haben nicht all die Rednerinnen und Redner bei den Gedenkfeiern der letzten Jahre, die mit Recht ihren Blick auf die Welt richteten und auch den Opfern der Kriege in der Gegenwart ihren Respekt zollten, haben sie nicht diese schwierige Frage umschifft? Ich denke: Wir müssen beides aushalten. Wir müssen den Verlust unserer jungen Männer ertragen (und sollten uns darum kümmern, wie sie sich im Krieg verhalten haben) – und
Wir müssen uns als Deutsche der
Erkenntnis stellen: Sprechen wir über das Leid dieser Männer, deren Namen dort aufgeschrieben sind, über das Leid der Ehefrauen, der Mütter und Väter, der Geschwister - und muten wir uns zu, uns mit dem Unheil, das Deutsche an zahllosen Orten anrichteten, auseinanderzusetzen! * Im Verlauf meiner Beschäftigung mit diesem Gedenkstein erwuchs mir aber noch ein weiteres Problem. Im November 1955, zehn Jahre nach dem Kriegsende, dankte der Vorsitzende der VdK-Ortsgruppe Erzhausen, Alfred Grabau, Bürgermeister Lotz für „die Patenschaft und das Erscheinen bei der öffentlichen Trauerfeier am Volkstrauertag“ und bat ihn, eine Anregung zu bedenken. Grabau schrieb: „Es wäre angebracht, dass auch in der Gemeinde Erzhausen eine würdige Mahnstätte für die Toten der Kriege, der politischen, religiösen und rassischen Verfolgung und der Heimatvertreibung geschaffen würde.“ Abgesehen davon, dass es mehr als 12 Jahre dauerte, bis im November 1968, endlich ein Mahnmal errichtet wurde, fragte ich mich: Ist dieser Würfel aus Muschelkalk, versehen mit einer Dornenkrone, dieses, vom VdK geforderte Denkmal? Er war ja ursprünglich nackt, trug, bis auf Jahreszahlen, keine Inschrift. Vielleicht, dachte ich, konnte man den Sinn, den das Denkmal haben sollte, damals nicht in der gebotenen Kürze ausdrücken. Vielleicht aber, das war und ist meine Vermutung, scheute man auch davor zurück, sich mit einem Text doch mehr mit der Vergangenheit beschäftigen zu müssen, als einem angenehm war. Also blieb es bei den bloßen Jahreszahlen 1939-1945 – bis 2002 zwei Männer aus dem Ortskundlichen Arbeitskreis (Valentin Lotz und Otto Schumann), die den Krieg als junge Männer überlebt hatten, für die Anbringung der Tafeln mit den Namen der umgekommenen Erzhäuser Soldaten sorgten. Ist das veränderte Denkmal nun das Mahnmal „für die Toten der Kriege, der politischen, religiösen, rassischen Verfolgung und der Heimatvertreibung?“ Nein, das ist es nicht. Die Anbringung der Bronzetafeln mit den Namen toter Soldaten und mit der Inschrift „Zum Gedenken an unsere Gefallenen und Vermissten des II. Weltkriegs“ verengt den Blick auf die Katastrophe dieses Krieges. Dieser Blick blendet die nationalsozialistische Diktatur sogar aus! Es sind eben nicht nur Soldaten umgekommen. Es sind doch auch Millionen Zivilisten gestorben (Tausende in unseren Nachbarstädten) - und es gibt Opfer der nationalsozialistischen Diktatur, Opfer der politischen, religiösen und rassischen Verfolgung – auch in Erzhausen. Von ihnen erzählt dieses Denkmal nichts. Sie haben, nicht nur deswegen, keinen Raum im kollektiven Gedächtnis unserer Gemeinde, wir sprechen nicht über sie. Fangen wir heute damit an. Der 8. Mai 1945, ein Dienstag, war in Erzhausen vermutlich kein Tag besonderer Ereignisse. Der Einmarsch der Amerikaner am 25. März lag schon sechs Wochen zurück, die Menschen im Dorf hatten sich schon an die täglichen Begegnungen mit den fremden Soldaten gewöhnt. Das Leben im Alltag war geprägt vom Hunger, von der Ungewissheit über die Zukunft – und belastet mit dem bitteren (meist stillen) Blick auf die jüngste Vergangenheit. Einige Erzhäuser jedoch wollten das, was in dieser jüngsten Vergangenheit geschehen war, nicht beschweigen. Am 6. Mai 1945 sandte August Eisinger, der von den Amerikanern wegen seiner klaren Gegnerschaft zum Nationalsozialismus als Hilfspolizist eingesetzt worden war, ein Schreiben an die „Politische Polizei in Darmstadt“, in dessen Anhang er „Dokumente, welche vom damaligen Bürgermeister Vollrath aufgenommen wurden“ beilegte.
Es geht darin um einen „tätlichen Angriff mit
Misshandlung und teilweiser Körperverletzung auf Angehörige der SPD und KPD
in der Nacht vom 6. auf den 7. März 1933.“ Heinrich Wannemacher gibt am 7. August 1945 zu Protokoll, dass er in der Nacht vom 12. auf den 13. November 1933 von SA-Leuten aus der Wohnung eines Freundes geholt, im Hof auf den Kopf geschlagen und, am Boden liegend, mit Fußtritten misshandelt wurde, so dass er sich allein nicht mehr aufrichten konnte. Seiner Vernehmung folgten einen Tag später, am 8. August 1945, Befragungen weiterer Erzhäuser. die alle in dieser Nacht Schläge und Misshandlungen erlitten. Heinrich Wannemacher, (und ein weiterer) Heinrich Wannemacher, Philipp Leiser, Philipp Keim, Georg Schroth, Marie Schroth, Karl Weber, Philipp Heinrich Ludwig, Jakob Hundsdorf, August Eisinger wurden in diesem ersten Jahr der nationalsozialistischen Herrschaft teils mehrmals aus ihren Wohnungen geholt, auf der Straße geschlagen, in Arrestzellen misshandelt, anschließend in Darmstädter Gefängnisse verbracht und – ein Hohn! – vom Nazi-„Sondergericht“ in Darmstadt wegen „Anwesenheit bei Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen“ (Tatvorwurf gegen Georg Schroth) zu Haftstrafen verurteilt. Allein Georg Schroth wurde im Jahr 1933 dreimal verhaftet. Er hat danach jedes Mal Gefängnishaft (einige Tage, 4 Wochen, 6 Monate) abgesessen.
Von Jakob Zissel, einem
Gemeindevertreter der SPD vor 1933, weiß ich aus Briefen meines Großvaters
Konrad Becker an seine Frau Katharine (meine Großmutter), dass er von 1937
bis 1940 drei Jahre im Gefängnis saß, weil er verbotene Schriften verteilt
hatte. Richard Krähkamp, an dessen Name sich heute in Erzhausen niemand erinnert, finden wir mit dem Vermerk „Wohnort Erzhausen, Kreis Darmstadt“ in der Zugangsliste des KZ Dachau aus dem März 1935. Karl Weber antwortet im Fragebogen der Militärregierung, den alle erwachsenen Deutschen 1945 auszufüllen hatten, auf die Frage: „Wurden Sie jemals, weil sie aktiv dem Nationalsozialismus Widerstand leisteten, in Haft genommen oder sonstwie in ihrer Freiheit beschränkt?“ Mit JA und benennt als Zeugen Philipp Keim und Heinrich Wannemacher.
August Lorenz wurde im August 1944
(nach dem 20. Juli) ins KZ Dachau gebracht, gemeinsam mit Tausenden
ehemaligen Mandatsträgern von SPD und KPD. Und es gibt auch Erzhäuser Verfolgte aus rassischen Gründen! Von Juden, die es in Erzhausen angeblich nicht gab, will ich hier nicht sprechen (wir müssten nur einen Blick auf die Verbindungen zu Juden aus den doch so vertrauten Nachbargemeinden Egelsbach, Gräfenhausen oder Arheilgen werfen oder uns der Familie Spiro zuwenden). Die Nationalsozialisten wollten ja nicht nur ihre politischen Gegner beseitigen. Sie wollten auch, in ihrer Sprache „für die Reinheit des Volkskörpers“ sorgen. Euthanasie! Heinrich Becker aus der Bahnstraße, Jahrgang 1908, wurde 1939 im Gesundheitsamt Darmstadt sterilisiert. Er litt an Epilesie. Philipp Lotz, Jahrgang 1913, wurde 1937 sterilisiert, nachdem er eine Ladung zum Gesundheitsamt bekommen hatte. Der Sohn von Georg Wesp, ein 19-jähriger, der, so sein Vater, „im Kopf nicht ganz normal war“, wurde im Darmstädter Krankenhaus sterilisiert.
Alfred Grabau sprach von Toten. Nur weil sie überlebten, vergessen wir die Erzhäuser Verfolgten nicht! Und erst recht nicht Heinrich Lindenlaub! Heinrich Lindenlaub aus der Egelsbacher Straße wurde, weil er wohl geistig behindert war und mit seiner Lebensführung manchen Erzhäusern zur Last fiel, ihnen aber auch Anlass für „Utz und Spott“ bot (so berichtet es sein Wohnungsgeber), im Sommer 1939 ins Philipps-Hospital Goddelau, von dort im November 1943 in die Klinik Eichberg im Rheingau und danach, im November 1944, in die so genannte „Landesheilanstalt“ Hadamar verbracht. Dort starb er am 11.11.1944. Es sei mir erlaubt, die abschließenden Worte von Bundespräsident Steinmeier aus dem Jahr 2020 auch ans Ende meiner heutigen Rede zu stellen: „Gedenken Sie heute der Opfer des Krieges und des Nationalsozialismus! Befragen Sie – ganz gleich, wo Ihre Wurzeln liegen mögen – Ihre Erinnerungen, die Erinnerungen Ihrer Familien, die Geschichte unseres gemeinsamen Landes! Bedenken Sie, was die Befreiung, was der 8. Mai für Ihr Leben und Ihr Handeln bedeutet! 80 Jahre nach Kriegsende dürfen wir Deutsche für vieles dankbar sein. Aber nichts von all dem Guten, das seither gewachsen ist, ist auf ewig gesichert. Deshalb rufe ich auch in diesem Sinn: Der 8. Mai 1945 war nicht das Ende der Befreiung – Freiheit und Demokratie sind bleibender Auftrag, unser Auftrag!“ Ich danke Ihnen! Klaus Becker |